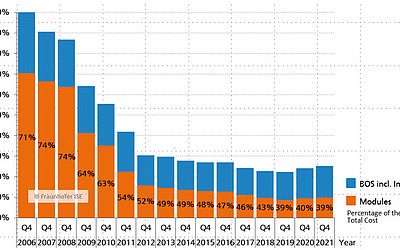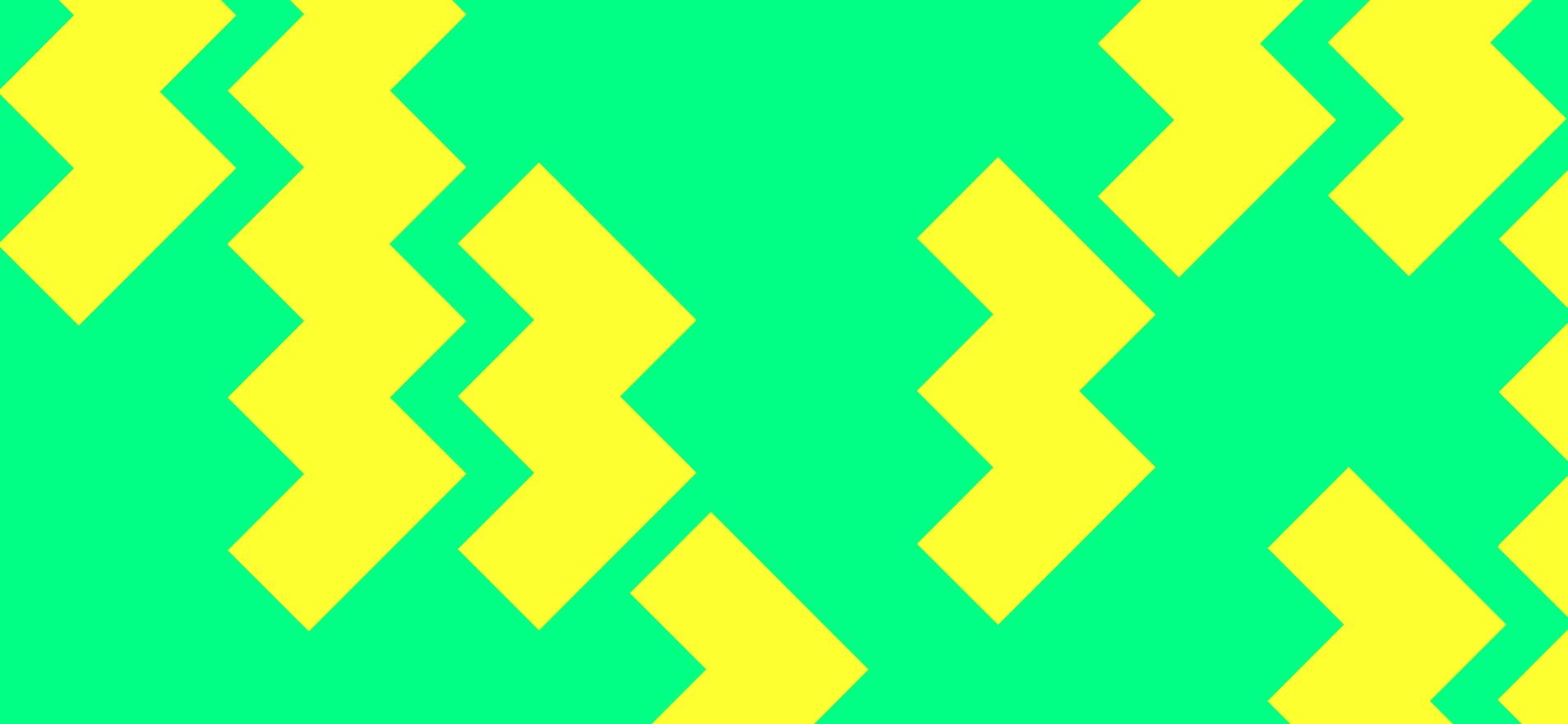PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Steuerliche Behandlung von Photovoltaikanlagen
Die steuerliche Behandlung der Photovoltaikanlage wird gerne bei der Planung der Anlage übersehen. Denn grundsätzlich wird jeder Betreiber einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage unternehmerisch tätig. Das hat weitreichende Folgen für die Berechnung der Einkommensteuer und vor allem auch bei der Umsatzsteuer. Bei größeren Anlagen kann zudem Gewerbesteuer anfallen.
Unternehmerische Tätigkeit
Eine Photovoltaikanlage sollte idealerweise Gewinn erwirtschaften. Sobald jedoch das Ziel einer Tätigkeit ist, dauerhaft Gewinn zu erzielen, liegt per Definition eine unternehmerische Tätigkeit vor. Für den Betreiber der Photovoltaikanlage bedeutet dies natürlich einen gewissen Mehraufwand.
Am einfachsten ist es, diese Angelegenheiten einem Steuerberater zu überlassen. Als erster Schritt sollte unbedingt dem Finanzamt die Installation der Photovoltaikanlage mitgeteilt werden. Außerdem sollte beim Ordnungsamt der Gemeinde nachgefragt werden, ob für die PV-Anlage eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.
Einkommensteuer und Abschreibungen
Ab 1. Januar 2023 sind gemäß dem Jahressteuergesetz PV-Anlagen mit einer Leistung bis 30 kW für Einfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien und bis zu 15 kWp je Wohnung oder Geschäftseinheit für Mehrfamilienhäuser bis zu einem Höchstwert von 100 kW pro Steuerpflichtigem von der Einkommensteuer befreit.
Diese Neuerung bedeutet eine Erweiterung der bisherigen Regelung, bei der nur Anlagen bis 10 kWp auf Antrag befreit waren. Die Einkommensteuerbefreiung entbindet Steuerpflichtige von der Verpflichtung zur Gewinnermittlung und der Erstellung einer "Einnahme-Überschuss-Rechnung", die oft nur mit Hilfe eines Steuerberaters durchgeführt werden konnte.
Diese Vereinfachung ist ein wichtiger Anreiz, um in Zukunft vorhandene Dachflächenpotenziale bestmöglich zu nutzen.
von Jörg P. aus Stuttgart
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENUmsatzsteuer
Eine weitere Ergänzung betrifft die Mehrwertsteuer für die Lieferung und Installation von PV-Anlagen auf Wohngebäuden, welche nun auf 0 % gesenkt wurde. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Anschaffungskosten.
Zusätzlich können Betreiber durch den Nullsteuersatz ohne Nachteile die bürokratiearme Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen.
Gesamtbetrachtung
Auf den ersten Blick erscheint vielen privaten Betreibern das Thema Steuern lästig. Bei genauer Betrachtung ist aber klar, dass durch den Vorsteuerabzug und diverse Abschreibungsmöglichkeiten die steuerliche Behandlung der Photovoltaik durchaus finanzielle Vorteile bringt. Die Vereinfachung zum 01.01.2023 setzt neue finanzielle Anreize für den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland.
Letzte Aktualisierung: 20.10.2023